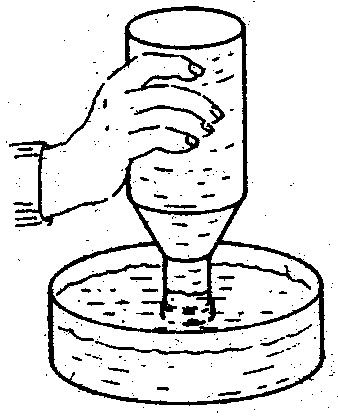
Die Versuche sind geordnet nach den Themen:
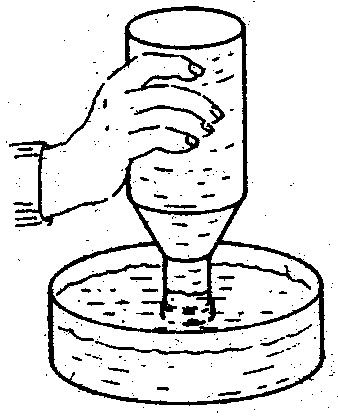
Eine
Wanne wird mit Wasser gefüllt. Eine
vollständig gefüllte Flasche wird mit dem Hals nach unten in die Wanne
eingetaucht.
Der Luftdruck verhindert das Auslaufen der Flasche.
Quellen (auch der Abbildung): Melenk-Runge, S.121.
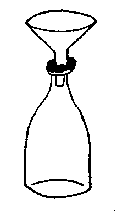
Auf eine leere Flasche wird ein Trichter platziert. Mit Knetmasse wird
der Raum zwischen Trichter und Flaschenhals luftdicht abgedichtet.
Wenn
man Wasser schlagartig in den Trichter schüttet,
so dringt kein Wasser in die Flasche ein,
da die Luft im Kolben nicht entweichen kann.
(Außer wenn man mit einem Strohhalm
die Wasserhaut durchsticht.)
Quellen: Gressmann, S.20;
Press, S.55; Melenk-Runge,
S. 54
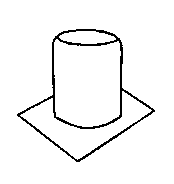
Ein Glas Wasser mit Bierdeckel oder Postkarte bedecken und umdrehen. Der Luftdruck hält das Wasser im Glas. Man könnte sich fragen, warum man dann den Bierdeckel braucht. Der Grund ist, dass die Wasserhaut allein nicht kräftig genug ist, um dem Luftdruck zu widerstehen.
Quellen: Oberdorfer, S.81, Backe, S.92,
Zeier1, S.:67, Melenk-Runge S.154;
Treitz, S.22,
Perelman2, S.72, Gressmann, S.98
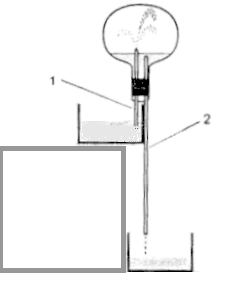
Wir brauchen einen Rundkolben mit etwas Wasser, doppelt durchbohrtem Stopfen und zwei Glasrohren. Wenn wir den Kolben umdrehen, so dass das kurze Rohr 1 in ein hoch stehendes Wasserbecken getaucht wird, dann sprudelt es aus dem Rohr 1 in den Kolben hinein und über das andere Rohr läuft Wasser in die Auffangwanne ab. (Wasser muss über Rohr 2 stehen. Durchs Ablaufen entsteht im Kolben ein Unterdruck, der äußere Luftdruck drückt das Wasser durch Rohr 1 nach.
Quellen (auch der Abbildung): Gressmann, S.21
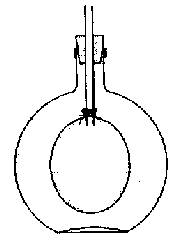
Wir benötigen: Eine bauchige Flasche, dazu passender Gummistopfen mit Bohrung, zur Bohrung passendes Röhrchen, Luftballon, Faden
Der Ballon wird über das Ende des Röhrchens gezogen und mit dem Faden umwickelt
und fest verknotet. Über das andere Ende des Röhrchens schiebt man den
Gummistopfen. Das Ganze setzt man lose auf den Flaschenhals (s. Abb.)
Der Ballon wird mit Hilfe des Röhrchens aufgeblasen und die Flasche mit dem
Stopfen verschlossen. Gibt man nun das Röhrchen frei, so entweicht keine Luft
aus dem Ballon.
Quellen (auch der Abbildung): Melenk-Runge, S. 118
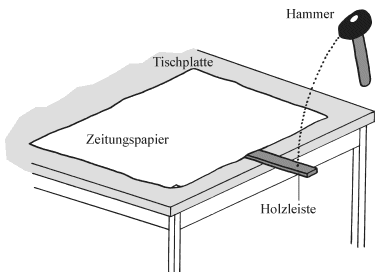
Man lege ein leichtes Brettchen (etwa eine dünne Holzlatte, z.B. aus Balsaholz) auf einen Tisch, so dass etwa 10cm davon über den Rand ragen. Nun zwei Doppelseiten einer Zeitung über den Tisch legen und flach streichen, bis sie eng an Tisch und Brettchen anliegt. Mit Hammer oder Hand kurz und kräftig auf das Brettchen hauen, durch den Luftdruck auf der Zeitung bricht es.
Quellen: Oberdorfer, S.68; Perelman2, S.100;
Zeier1, S.91, Gressmann, S.43
Variation: Wittmann1, S.50
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
Ein ähnlicher Versuch mit Brettchen, Schnur und Zeitung ist hier zu sehen. Man ziehe jeweils die an den Brettchen befestigte Schnur nach oben - einmal ohne Zeitung, einmal mit Zeitung.
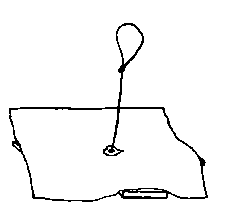 |
||
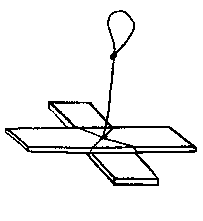 |
Einen Luftballon unter einen Stapel Bücher legen und dann den Ballon aufblasen.
Zwei neue Luftballons werden verschieden stark aufgeblasen und mit einem Glasrohr mit geschlossenem Hahn verbunden. Wird der Hahn geöffnet, so geht die Luft vom kleineren zum größeren Ballon. Im kleinen Ballon ist der Luftdruck größer, daher wird er noch kleiner.
Quellen: Becker, S.44; Gressmann, S.77,
Bublath1-17, Bublath5-39
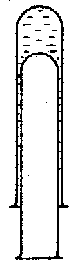
Zwei ineinander gesteckte Reagenzgläser mit Wasser dazwischen: Das untere
fällt nicht runter, sondern bewegt sich nach oben.
Erklärung: Da das Wasser aus dem äußeren Reagenzglas heraus fließt, aber keine
Luft nach oben geht, entsteht ein Unterdruck, durch den sich das innere
Reagenzglas nach oben bewegt.
Quellen: Melenk-Runge, S.159 (Quelle der Abbildung); Wittmann1, S.17; Kratz2, S.61, Zeier1, S.94
 Magdeburger Halbkugeln (Luftdruck)
Magdeburger Halbkugeln (Luftdruck)
Ein Wattebausch wird in einem Glas angezündet. Auf das Glas wird angefeuchtetes Papier (Löschblatt) gelegt. Ein zweites Glas wird mit der Öffnung nach unten darauf gestellt.
Wenn die Flammen verloschen sind, kühlt sich die Luft im Glas ab und es entsteht ein Unterdruck. Dadurch werden die Gläser zusammengepresst.
Quellen: Gressmann, S.99, Oberdorfer, S.70, Cherrier, S.24, Lanners, S.74, Press, S.51 .
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
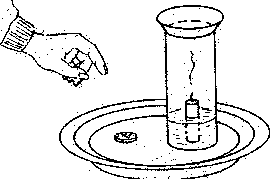
Auf einer Untertasse mit etwas Wasser steht eine brennende Kerze. Daneben liegt eine Münze. Wenn man ein Trinkglas über die Kerze stellt, geht diese aus und das Wasser wird ins Glas gesaugt.
Es ist nicht der fehlende Sauerstoff, sondern die sich zusammenziehende Luft, die dieses bewirkt. Man kann dies nachprüfen, indem man die Kerze wegstellt, das Trinkglas erwärmt und dann über die Untertasse stülpt.
Quellen: Melenk-Runge, S.157 (auch Abbildung); Perelman2, S.74; Zeier1, S.87, Gressmann, S.103; Press, S.52; Backe

Eine Coladose mit etwas Wasser darin erwärmen. Der Wasserdampf verdrängt die Luft aus dem Gefäß. Dann mit Hilfe einer Zange die Dose in eine Wanne mit Wasser legen. Die Dose implodiert.
Quellen: Oberdorfer, S.73, Backe, S.90;
Melenk-Runge, S.135; Wittmann2, S.15;
Kratz3,1.17,
Gressmann, S.100, Press, S.150,
Bublath5-40
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".

Einen Papierstreifen oder Streichholz anzünden, in eine Milchflasche mit breitem Hals
werfen und ein acht Minuten lang
gekochtes und geschältes Ei auf den Hals der Flasche setzen. Durch den
Unterdruck der abkühlenden Luft gleitet das Ei hinein.
Das Ei geht wieder raus, wenn man die Flasche umdreht, senkrecht nach oben hält und
von unten hinein
bläst. Dadurch wird die Luft komprimiert und das Ei schießt nach Abnehmen der Flasche
vom Mund raus.
Quellen: Oberdorfer, S.78, Backe, S.92, Lanners, S.75, Bublath1-8
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexperimente".
Wir messen genau genommen die "Vitalkapazität". Darunter versteht man
die. Differenz zwischen kleinstem und größtem Rauminhalt der Lunge.
Ein Eimer durchsichtiger Eimer wird mit Wasser gefüllt und umgedreht
in ein Wasserbecken gelegt. Die Versuchsperson muss mit einem Schlauch
in den Eimer blasen. Ein Partner hält den Eimer so, dass der
Wasserspiegel innen und außen gleich bleibt (sonst entsteht Druck).
Zur Messung des Volumens:. Wenn der Eimer keine Skala hat, dann Wasserstand
nach Ausatmen markieren. Eimer wegnehmen, ausleeren und bis zur Markierung
füllen. Das dazu benötigte Wasser wiegen.
Quellen: Moisl1, S.20
Du wirst es nicht schaffen, ein im Flaschenhals einer horizontal gehaltenen
Flasche liegendes Papierkügelchen in die Flasche hinein zu pusten, da
in der Flasche ein Überdruck entsteht.
Quellen: Oberdorfer, S.66,Wittmann1, S.13
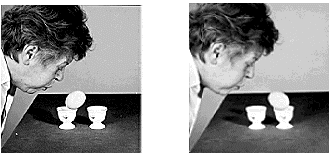
Zwei Eierbecher werden nebeneinander gestellt. In einen Eierbecher wird ein Ei hinein gesetzt. Mit ein bisschen Geschick kann man durch kräftiges Pusten in den ersten Eierbecher das Ei in den zweiten befördern.
Quellen: Oberdorfer, S.65, Wittmann1, S.12, Lanners, S.62, Press, S.45; Bublath1-4
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexperimente".
Trichter am schmalen Rohr zuhalten und mit der großen Öffnung
nach unten ins Wasser halten. Der Luftdruck drückt die Luft im Trichter
zusammen. Beim Öffnen des Trichters findet ein Druckausgleich statt,
der auch Wasser mitreißt.
Quellen: Oberdorfer, S.94
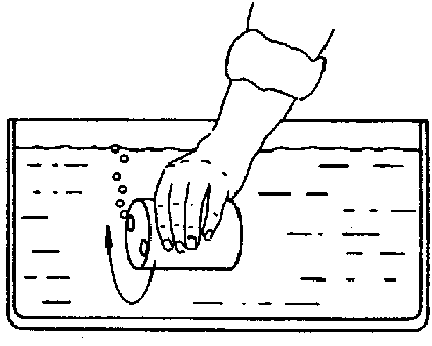
Ein leere Milchdose mit zwei Löchern in der Deckel- oder Bodenfläche wird in eine
Glaswanne mit Wasser gehalten.
Sind beide Löcher nach oben gerichtet, so dringt kein Wasser in die Dose ein
(keine Luftblasen). Ebenso, wenn beide Löcher nach unten zeigen sowie wenn sie
seitlich in gleicher Höhe liegen.
Erst, wenn ein Loch höher liegt als das andere (s.Abb.), dann sprudeln
Luftblasen aus dem oberen Loch und Wasser dringt durch das untere in die Dose
ein.
Quellen (auch der Abbildung): Melenk-Runge, S. 52
Schießt man mit Luftgewehr auf gekochtes Ei , so wird es durchbohrt;
ein rohes dagegen platzt in alle Richtungen. (Wasser inkompressibel; Gleiten
auf Wasser)
Quellen: Bublath2-8, Bublath4-34
In eine Flasche in unterschiedlicher Höhe Löcher gleicher Größe bohren. Durch
das untere Loch spritzt das Wasser am weitesten, wenn die Flasche hoch genug
steht.
Quellen: Oberdorfer, S.101
Eine leere Flasche als Schiff in eine Wasserbecken legen, einen dünnen
Schlauch in die Flasche legen und hinein blasen. Das Schiff steigt.
Quellen: Treitz, S.4
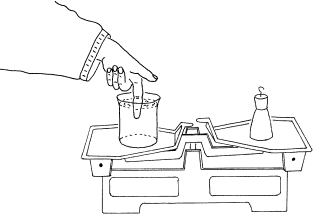
Glas Wasser auf eine Balkenwaage stellen. Steckt man den Finger in das Glas, so erfährt der Finger eine Auftriebskraft durch das Wasser nach oben. Als Gegenkraft übt der Finger auch eine Kraft nach unten auf das Wasser aus. Die Waagschale mit dem Glas sinkt. Bringt man die Waage durch Hinzufügen von Wägestücken auf die andere Schale wieder ins Gleichgewicht, kann man damit die Masse des verdrängten Wassers ermitteln. Dies kann als Schätzwert für die Masse des Fingers dienen, wenn man annimmt, dass die Dichte des Fingers gleich der Dichte des Wassers ist.
Quellen: Oberdorfer, S.92
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
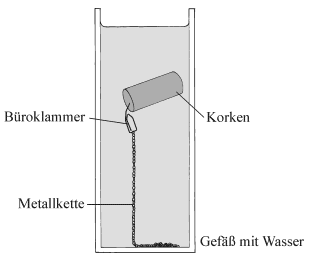
Lege Kette mit dran befestigtem Korken in ein Glas und fülle Wasser
ein. Zunächst schwimmt der Korken über der Oberfläche, aber je mehr Wasser
eingefüllt wird und je mehr Kettenglieder sich heben, um so weiter sinkt der
Korken ab.
Der Grund ist die wachsende Gewichtskraft der herab hängenden Kettenglieder, die
durch höheren Auftrieb (tieferes Eintauchen) ausgeglichen werden muss.
In Salzwasser ist der Auftrieb stärker (höhere Dichte), deswegen steigt der
Korken bei Zugabe von Salz nach oben.
Quellen: Treitz, S.8; Bürger,
S.19
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
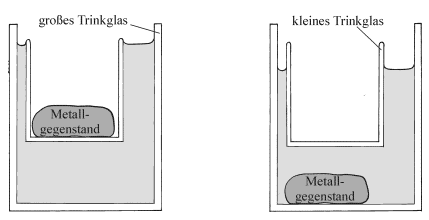
Nimm eine Hälfte des Plastik-Eis aus einem Überraschungsei, lege eine große Murmel hinein und lasse das ganze in einem Glas Wasser schwimmen. Markiere den Wasserstand. Drücke dieses Schiff unter Wasser und der Wasserstand sinkt. Die Abbildung zeigt den Versuch etwas abgeändert.
Quellen: Treitz, S.11
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
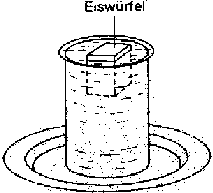
Steigt der Meeresspiegel, wenn das Eis am Nordpol schmilzt?
Läuft ein randvolles Glas Wasser mit einem Eiswürfel darin über, wenn das Eis
schmilzt?
Die Antwort lautet in beiden Fällen: Nein.
Quellen: Treitz, S.133; Melenk-Runge,
S.62 (Quelle der Abbildung);
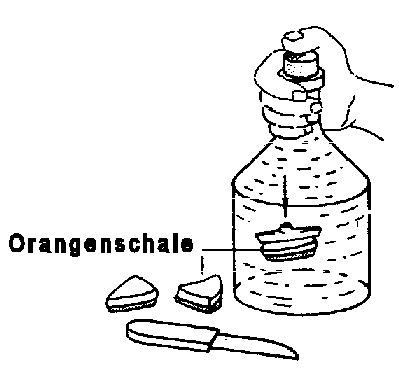
Ein Boot aus einer Orangenschale oder eine Glasfigur in eine volle Flasche setzen und mit einer Gummikappe schließen. Bei Druck auf die Kappe sinkt der Taucher. Winzige Bläschen in der Schale bewirken, dass sie schwimmt. Durch den Fingerdruck wird der Druck im Wasser größer und der Auftrieb geringer. In der Glasfigur wird die Luft im Kopf zusammengedrückt.
Quellen:
Oberdorfer, S.100, Melenk-Runge,
S.62 (Quelle der Abbildung); Treitz, S.5; deVries;
Cherrier, Kikoin, S.11,
Becker, S.68, Ward, S.52,
Mie/Frey:,S.28; Press, S.71
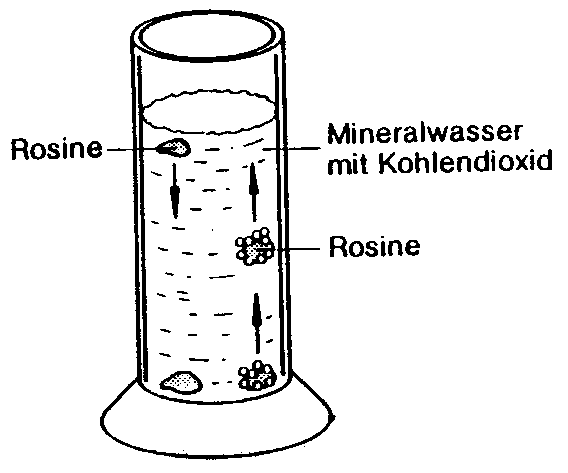
In ein hohes Glasgefäß wird Mineralwasser gefüllt.
Dann lässt man einzelne Rosinen hinein fallen.
Quelle (auch der Abbildung): Melenk-Runge, S.60
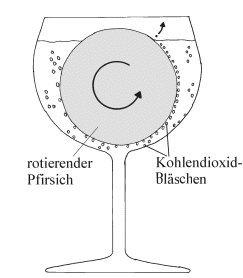
Einen Pfirsich (oder Traube) vorsichtig in ein Glas mit Sprudel legen und leicht anstoßen. Er beginnt sich durch die Kohlendioxid-Bläschen zu drehen. Diese setzen sich an ihm fest, was Auftrieb bewirkt. Beim Anstoßen platzen die Bläschen an der Luft, und die neu entstandenen halten ihn in Bewegung. Etwas einstechen verstärkt den Effekt.
Quellen: Oberdorfer, S.82, Kratz-Mec6,
Kratz3,1.7, Press, S.69
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
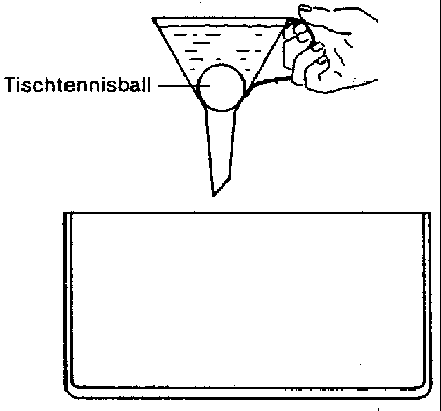
Ein Tischtennisball wird in einen Trichter gelegt und mit dem Finger fest
gehalten. Dann wird Wasser hinein gegossen.
Wenn der Trichter voll ist, lässt man den Ball los. Heraus fließendes Wasser
wird in einer Wanne aufgefangen.
Der Ball bleibt unten. Zum Schwimmen ist der Druck des darunter befindlichen
Wassers erforderlich, und der fehlt hier (da das Wasser abfließt).
Hält man den Finger von unten gegen die Trichteröffnung, so schwimmt der Ball.
Quellen: Wittmann1, S.20; Melenk-Runge, S. 65 (Quelle der Abbildung)
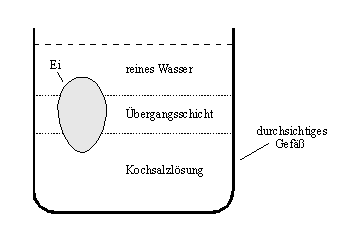
Ein Glas zur Hälfte mit einer gesättigten Salzlösung (mind. 10 EL Salz pro Liter) füllen. Mit einem Löffel vorsichtig Leitungswasser dazugeben, ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen. Legt man ein Ei hinein, so wird es in der Mitte schweben, da es leichter als die Salzlösung ist.
Quellen: Oberdorfer, S.88, Perelman2, S.68, Ward, S.48, Bublath1-22, Moisl1, S.42
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexperimente".
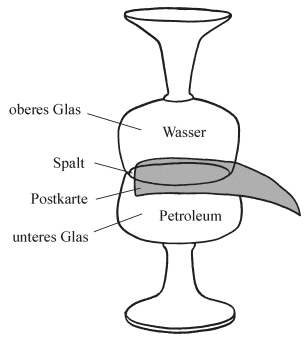
Man nehme zwei gleiche Wein- oder Schnapsgläser, fülle das erste mit gefärbtem Wasser, das zweite mit Spiritus (oder Petroleum) jeweils randvoll. Auf das Wasserglas wird eine Postkarte gelegt und dann das Wasserglas umgedreht auf das andere Glas gestellt. Die Karte verschieben, so dass ein kleiner Schlitz entsteht, durch den die Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Durch diesen Schlitz fließt das Wasser nach unten und die leichtere Flüssigkeit steigt nach oben.
Quellen: Oberdorfer, S.85, Melenk-Runge,
S.67 (Quelle der Abbildung); Wittmann2, S.6, Lanners, S.57
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
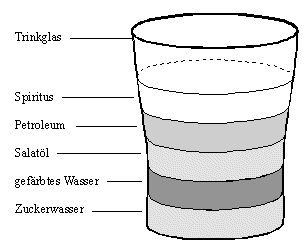
In ein Glasgefäß folgende Flüssigkeiten behutsam hinein geben: Zuckerwasser (oder Sirup), mit blauer Tinte gefärbtes Wasser, Salatöl , gefärbtes Petroleum, Spiritus. Die Dichte der Stoffe wird von unten nach oben immer kleiner, d.h. die Flüssigkeiten schwimmen aufeinander. Da sie sich sehr langsam mischen, bleibt die Anordnung einige Zeit erhalten. Für verschiedene Probekörpern unterschiedlicher Dichte kann man untersuchen, wie weit sie sinken.
Quellen: Oberdorfer, S.97, Wittmann2, S.96
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
Spanne ein Stück Stoff mit Hilfe eines Gummirings über eine mit
Wasser gefüllte Flasche. Beim Umdrehen der Flasche geht nichts raus.
Quellen: Gressmann, S.81, Bublath1-119
Eine Stecknadel auf Zeitungspapier legen, beides auf eine Wasserfläche
tun. Wenn das Papier voll gesogen ist, wird es ins Wasser gedrückt, und
die Nadel schwimmt (ebenso gefettete Nadel).
Quellen: Oberdorfer, S.89, Backe, S.82, Perelman2, S.70, Ward, S.50, Lanners, S.107, Zeier1, S.56
Variation: Schwimmende Rasierklinge Melenk-Runge, S.69
. Münze: Bublath1-19
In ein volles Wasserglas kann man 1000 Stecknadeln oder viele Münzen hinein legen, ohne dass es überläuft. Es entsteht eine sich wölbende Wasserhaut.
Quellen:
Zeier1, S.63
Mische 750 g Neutralseife, 25 g Tapetenkleister und 500g Zucker mit einem
Liter Wasser und lasse es 24 Stunden stehen. Dann die übrigen 9 Liter
Wasser dazu.
Aus Elektrikerdraht verschiedene Figuren und Kreise herstellen. Von einer
gewissen Größe an lassen sich die Blasen nur noch ziehen, nicht
mehr blasen. Auch aus einem Trichter lassen sich Seifenblasen blasen (Seifenlauge
ist sehr elastisch). Quellen: Oberdorfer, S.103,
Bublath1-16ff
Ein Einfachrezept für Seifenblasen ist 2 EL Spülmittel pro Liter Wasser;
evtl. paar Tropfen Glyzerin.
Quellen: Oberdorfer; Bublath3; deVries, S.117, Becker, S.44, Zeier1, S.57
Seifenblasen werden von Oberflächenspannung. zusammengedrückt und
können daher durch Glasrohr Kerze ausblasen.
Gressmann, S.76
Gut für Blasen sind auch mit Wolle umwickelte Bleistifte. Effektvoll
ist es, die Blasen mit Zigarettenrauch zu füllen (aufblasen) und ein
Loch hinein zu machen (Vulkan).
Aus einem Draht ein Viereck formen und eine Schlaufe mit dünner Schnur/Faden
hinein binden. Drahtgestell in Seifenlösung tauchen und mit einem spitzen
Gegenstand mitten in die Schlaufe stechen. Diese formt sich sofort zu einem
Kreis, da der Seifenfilm sich zur kleinstmöglichen Fläche
zusammenzieht, also muss die Schlaufe die maximale Fläche einnehmen.
Quellen: Oberdorfer, S.104, Backe, S.83
.
Ein Glas Wasser mit Lebensmittelfarbe einfärben. Die Sellerie unten
abschneiden und bei einer Stange die Blätter entfernen. Beide Stangen
ins Wasser stellen. Nach ein paar Stunden die äußere Haut entfernen:
In der Pflanze mit Blättern ist die Farbe höher. Blätter helfen
mit.
Quellen: Oberdorfer, S.120, Press
Stelle dich auf Bierdeckelstapel in Wasser und du (oder ein Gewicht) wird
hochgehoben.
Quellen: Bublath2-2, Kratz3,1.20
Variation (Zaubersprudel): In Bierdeckel drei Löcher stupfen, auf
volles Glas legen, umdrehen und Finger auf Löcher halten. Lässt
du Finger los, zischt im Glas Luft empor. (Bierdeckel saugt an, Unterdruck
im Glas). Press, S.77
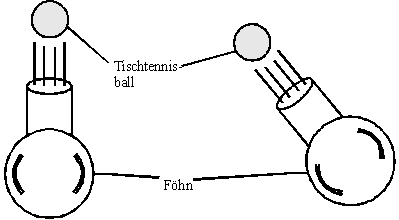
Im Luftstrom eines Föns schwebt ein Tischtennisball. Hinter dem Ball ist ein Unterdruck, auf Grund höherer Strömungsgeschwindigkeit. Wenn Ball gewölbte Fläche berührt, dann Abstoßung.
Quellen: Oberdorfer, S.77, Gressmann, S.113,
Bublath5-88
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
Ein Ei 10 min kochen, dann Ei in Pfanne abschrecken. Dabei Wasserstrahl genau
zwischen Ei und Pfanne richten. Das Ei rollt auch bei schräger Pfanne
nicht weg.
Quellen: Oberdorfer, S.90, Press, S.72
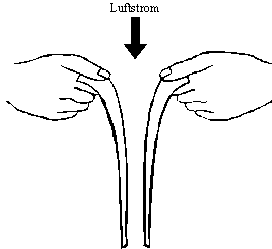
Mit einem glühenden Nagel je ein Loch in zwei Tischtennisbälle stechen. Ein kleines Streichholzstück an einen 30cm-Faden binden (2x) und damit jeden Ball an Stab binden, so dass die Bälle in ein paar Zentimeter Abstand hängen. Mit Strohhalm kräftig zwischen die Bälle pusten, die Bälle gehen aufeinander zu.
Die Abbildung zeigt eine Variante mit Papierstreifen.
Quellen: Oberdorfer, S.67
Variante: Unter eine Garnrolle ein Stück Pappe halten. Von oben durch die Rolle blasen und Pappe loslassen. Sie klebt an der Rolle.
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexperimente".
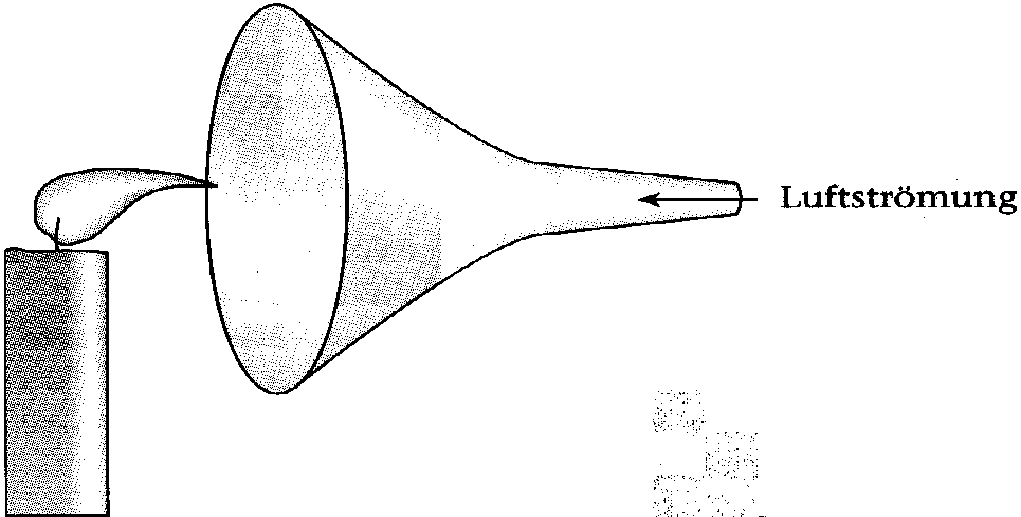
Wenn der Trichter mit seiner großen Öffnung auf eine Kerze gerichtet
ist, kann man die Kerze nicht ausblasen, da der Luftstrom auseinander geht.
Die Flamme wird sogar zum Trichter hingezogen, da dort wegen der Luftströmung
ein Unterdruck herrscht.
Quellen: Korthaase, S. 55 (auch Quelle der Abbildung), Oberdorfer, S.64, Wittmann1, S.52; Zeier1, S.103, Gressmann, S.110 (mit Variationen)
Ebenso lässt sich bei senkrecht nach oben gehaltenem Trichter der Ball nicht aus dem Trichter hinaus blasen. Press, S.45
Endpunkte des Durchmessers auf Münze markieren. Mit Nadeln Münze
an diesen Punkten hochheben und über die obere Hälfte blasen.
Münze dreht sich wie ein Propeller, da ein Sog entsteht (schwierig!).
Quellen: Oberdorfer, S.76
In ein kegelförmiges Glas eine kleine Münze auf den Boden legen
und darüber eine größere Münze als Deckel. Durch geschicktes
kraftvolles Pusten dreht sich die obere Münze, übt einen Druck
auf die kleinere aus, so dass diese in hohem Bogen rausfliegt.
Quellen: Oberdorfer, S.74; Lanners, S.61
Mit einer Pipette einen Tintentropfen in ein Wasserbecken tropfen. Es entsteht ein Wirbelring, der wieder neue erzeugt.
Quellen: Oberdorfer,
S.86,123
Halte eine Messerklinge unter einen dünnen Wasserstrahl. Du siehst eine
wellige Form. Das Phänomen ist laut Walker ( S. 107) unerforscht.