
Die Versuche sind geordnet nach den Themen:
Kräfte
(sechs Versuche)
Schwerpunkt,
Kräftegleichgewicht (sieben Versuche)
Trägheit (fünf
Versuche)
Impuls, Energie
(vier Versuche)
Freier Fall (zwei
Versuche)
Reibung (vier
Versuche)
Drehbewegungen,
Trägheitsmoment, Rotationsenergie, Zentrifugalkraft (zehn Versuche)
Schwingungen
und Wellen zwei Versuche)
Druck (zwei
Versuche)

Wir brauchen eine Garnrolle mit Faden oder zwei Räder und eine Achse mit Schnur. Zieht man nach oben, so rollt das Ding weg; zieht man waagerecht, so rollt es her.
Quellen: Press, S.94; Oberdorfer, S.27; Treitz, S.43; Bublath2, Kap.7 ; Bürger, S.13, Zeier, S.53
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexpeimente".
Variation : Das paradoxe Fahrrad
Eine Schnur wird am Pedal eines Fahrrads befestigt. Man zieht dann waagerecht
nach hinten. Rollte dann das Fahrrad nach hinten oder nach vorne? Bürger, S.13
Wenn man mit dem rechten Arm etwas ganz schweres hält, danach etwas anderes in die linke Hand und etwas schwereres in die rechte nimmst, kommt dir der Gegenstand der rechten Hand leichter vor.
Quelle: Treitz, S.56
Eine Schnur mit einem Millimeter Durchmesser wird um die Hand gewickelt. Um den Daumen wird lose eine Schlaufe gewickelt, Die Schnur wird hinter der Hand wieder durch die Schlaufe gezogen. Wenn man mit einem Ruck an der Schnur zieht, reißt sie sofort, da durch die Schlaufe sich die Kraft auf zwei Teile verteilt.
Quelle: Oberdorfer, S.25
Ein Blatt Papier wird im Zickzack gefaltet und auf zwei Gläser gelegt. Das Papier hält ein volles Glas Wasser.
Quellen: Press, S.92; Oberdorfer, S.26; Bublath5, Kap.47; Zeier, S.14

Zwei Personen auf Rollschuhen oder -brettern halten ein Seil und ziehen
daran. Oder es zieht nur eine Person und die andere hält das Seil: Sie treffen
sich auch dann an der gleichen Stelle.
Variation: Schüler auf Rollbrett
fängt und wirft Medizinball.
Quellen: Backe; Gressmann, S.22 (Quelle der Abbildung)

Versuchsaufbau wie in der linken Abbildung. Wenn ein Massestück
mit der Masse ein Kilogramm an der Schnur hängt, so zeigt der Federkraftmesser
10 N an.
Beim zweiten Versuch (rechte Abbildung) wird die Stange links durch ein weiteres
Massestück mit der Masse ein Kilogramm ersetzt. Es hängen also zwei Kilogramm an
der Schnur. Dennoch zeigt der Federkraftmesser wie bisher 10 N an.
Damit ein Federkraftmesser etwas anzeigt, müssen zwei Kräfte an ihm wirken. Beim
ersten Versuch waren das Stange und Massestück, beim zweiten Versuch die beiden
Massestücke. Der Federkraftmesser zeigt aber nur den Betrag einer
Kraft an.
Quellen (auch der Abbildung): Melenk-Runge, S.38

Durch eine Kerze wird quer ein langer Nagel als Achse gesteckt. Der Nagel
wird auf zwei Gläsern gelagert. Die Kerze wird an beiden Enden angezündet. Am
tieferen Ende brennt sie schneller, dadurch wird sie leichter und wippt auf die
andere Seite. Nun geschieht dasselbe auf der anderen Seite usw.
Quelle: Oberdorfer, S.106
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexpeimente".
Zwei längliche Pappkartons, einer mit Bleistück innen drin, werden über eine Tischkante geschoben. Wunderbarerweise fällt der eine nicht runter.
Quellen: Melenk-Runge, S.32
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexpeimente".

In den Korken einer Flasche stoßen wir eine Nähnadel . Wir teilen zwei weitere Korken und stecken vier Gabeln an die Enden der Schnittflächen. Dann belasten wir einen Teller mit den vier Korkgabeln und legen ihn auf die Nadel. Wenn der Schwerpunkt auf der Nadel liegt (Gleichgewicht), dann können wir den Teller leicht drehen.
Quellen: Oberdorfer, S.28; Lanners, S.15; Moisl1, S.46
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexpeimente".
Drei Gläser werden in Dreiecksform angeordnet. Auf jedem Glas liegt ein messer. Die messer liegen in der Mitte des Dreiecks so aufeinander, dass eines immer über dem zweiten und unter dem dritten liegt. Eine Karaffe steht dann stabil auf den drei messern.
Quellen: Oberdorfer,
S.35; Lanners, S.24
Ein Flasche wird auf ein mit Kreide aufgerautes Seil gelegt. Dann wird ein
Regenschirm in den Hals der Flasche gesteckt und das ganze ausbalanciert.

Unweit der Spitze eines spitzen Bleistifts wird die halb aufgeklappte Klinge eines Taschenmessers eingesteckt. Eine zweite Klinge wird ebenfalls halb aufgeklappt. Der Bleistift bleibt mit der Spitze nahe einer Tischkante stehen. Zusätzlich kann zur Stabilisierung an Löffel an der unteren Klinge befestigt werden.
Quellen: Oberdorfer, S.38; Lanners, S.15; Moisl1, S.49
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexpeimente".
Ein Latte wird mit einer Papierschlaufe versehen und über eine Tischkante
gelegt. In die Schlaufe legen wir einen Hammer, so dasssich der Kopf unter der
Tischplatte befindet.
Auf eine Person wird eine schwere Eisenplatte gelegt. Dann schlägt man mit einem Hammer auf die Platte.
Quelle: Kratz2, S.66
1. Ein Tischtuch wird unter einigen Tassen weggezogen. Zeier, S.32
2. Domino-Turm.
Aus einem Stapel Dominosteine den untersten rausschnippen. Zeier, S.32
3. Trägheit der
Gase: Laterne schwingen. Flamme wendet sich in Bewegungsrichtung. Press, S.91
4. In einen
Papierstreifen zwei Einschnitte machen. Beim Auseinanderziehen des Streifens
reißt das Papier nur in zwei
Teile. Perelman2, S.120
Ein Halbkarton (10cm auf 10cm) wird auf dem linken Zeigefinger ausbalanciert.
Eine Münze wird draufgelegt und dann versuche mal, mit dem rechten Zeigefinger
den Karton wegschleudern. Die Münze bleibt nach viel übung auf dem Finger
liegen.
Quellen: Oberdorfer, S.30; Melenk-Runge, S.32; Lanners, S.34
Variationen: Münze auf Karton und das ganze auf ein Wasserglas legen. Der
Karton wird mit Hilfe eines Fadens weggezogen. Zeier, S.31
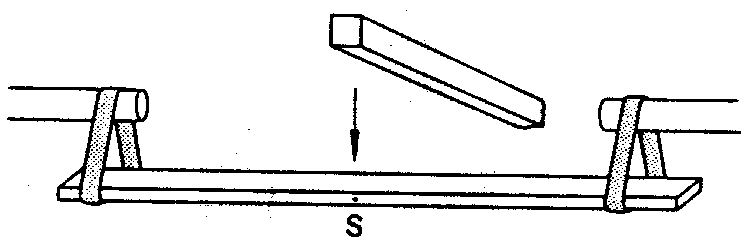
Ein dünner Sperrholzstab wird durch zwei Papierschlaufen gelagert oder auf zwei Gläser gelegt. Mit einem Stock und viel Schwung kann man den Stab durchschlagen, ohne dassdem Papier bzw. Glas etwas zustößt.
Quellen: Melenk-Runge,
S.30 (Quelle der Abbildung); Lanners, S.54; Wittman1, S.25; ,Zeier, S.33; Perelman2; Gressmann, S.42, Bublath5-40

Ein Gewichtsstück wird an einem Faden aufgehängt. Ein Teil des Fadens hängt noch unter dem Massenstück. Zieht man an diesem unten hängenden Faden langsam, so reißt der Faden über dem Massenstück; zieht man schnell, so reißt der Faden darunter.
Quellen: Wittmann2, S.41; Zeier, S.33, Perelman2, S.119; Gressmann, S.37; Borucki, S.49, Moisl1, S.59; Bublath 7-2
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexpeimente".
Ein kleiner Superball (aus Vollgummi) wird auf einen größeren geklebt (mit Kaugummi oder KlebMasse). Dann werden beide aus 1,5 m Höhe fallengelassen. Der kleine bekommt den Impuls des anderen und springt mehrere Meter hoch
Quellen: Oberdorfer,
S.29; Wittmann1, S.86; Kratz,Mec1, Kratz2, S.66
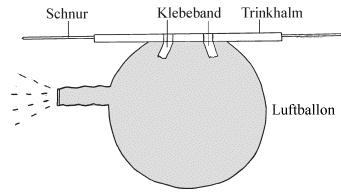
Eine langer Perlon- oder Nylonfaden wird durch einen Trinkhalm gefädelt und aufgehängt. Ein Luftballon wird aufgeblasen, zugehalten und mit Klebeband am Trinkhalm befestigt. Dann Ballon loslassen.
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexpeimente".
Quelle : Ardley2, S. 13
Weitere Möglichkeiten:
1. Luftballon als Rückstoßantrieb für ein Schienenfahrzeug .
2. Auf einen Wagen wird ein Fön gelegt und befestigt. Der Wagen wird von einer
Feder gehalten. Bei laufendem Fön spannt der Rückstoß die Feder.
Quelle: Gressmann. S.106
3. Auf einem Holzbrettchen steht ein Teelicht. Darüber ist ein metallenes
Tablettenröhrchen , das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Das Teelicht erwärmt
und verdampft das Wasser, der Dampf treibt das Boot durch Rückstoß an.
Quelle: Oberdorfer,
S.95, Kratz-Mec8
Weitere Anregungen: Kratz-Mec8; Oberdorfer, S.79; Backe, S.74; Bublath3; Zeier:, S.95; Ardley, Press, S.53

Ein Papier- oder Styroporfisch mit Loch in der Mitte, von dem ein Kanal zum Schwanz führt,
schwimmt in einer Schüssel. Wenn man Spiritus in das Loch im Fisch tropft, schwimmt
der Fisch davon.
Quellen: Oberdorfer, S.87; Kratz-Mec8; Lanners, S.104; Zeier, S.75
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische Freihandexpeimente".
Variation: Der Wassermotor Wittmann1, S.42 .
Ein Brett mit Löchern für Steckstifte senkrecht stellen. Am obersten Steckstift ein Pendel befestigen. Während des Schwingens auch Stifte in die Löcher darunter stecken, dadurch wird die Amplitude verkürzt, die Frequenz sollte jedoch gleich bleiben Energieerhaltung
Quelle: Oberdorfer, S.40
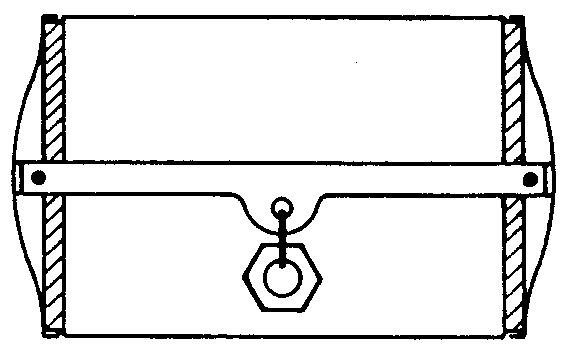
In eine Blechdose mit abnehmbaren Deckel auf jeder Stirnseite zwei Löcher bohren und ein Gummiband durch die öffnungen führen und in der Innenseite die sich kreuzenden Bänder mit Wägestück und Faden fixieren. Beim Runterrollen kann das Gummi Energie speichern, so dassdie Dose bergauf rollt.
Quellen: Melenk-Runge,
S.46 (Quelle der Abbildung),
Mie/Frey, S.229, Gressmann, S.57
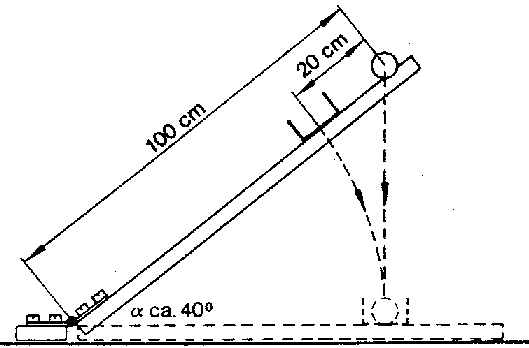
Wir brauchen zwei Holzleisten mit Scharnier Auf der einen wird ein Loch (oder Becher) für einen kleinen Ball angebracht und zehn Zentimeter daneben eine kleine Blechdose . Lässt man das Brett fallen (leicht beschleunigen), so landet der Ball in der Dose.
Quellen: Oberdorfer,
S.47; Treitz, S.64; Melenk-Runge, S.35 (Quelle der Abbildung); Wittmann1, S.64; Bürger, S.83, Gressmann, S.33
Ein Stein oder Buch liegt auf einem Brett , das von einem Faden gehalten wird. Zwischen dem Stein und dem Brett liegt ein Blatt. Der Faden wird durchgeschnitten und im Fall gleitet das Papier raus. Für einen weichen Aufprall sollte man vorsorgen.
Quelle: Wittmann2, S.39; Zeier, S.35
Andere Möglichkeiten: Brennende Lampe (Kerze) im freien Fall. Buch liegt auf
Waage und beides fallenlassen

Halte die Hände etwa einen Meter auseinander und lege einen Stab (Besenstiel,
Meterstab) über die Zeigefinger. Dann schließe die Augen und fahre mit einem
Finger in die Mitte. Nach welcher Seite fällt er? Gar nicht, die Finger werden
genau im Schwerpunkt ankommen.
Erklärung: Anfänglich ist beim gleitenden Finger die Reibung geringer als beim
ruhenden, da die Gleitreibung kleiner als die Haftreibung ist.
Beim gleitenden Finger nehmen dann die Auflagekraft und damit die Gleitreibung
zu, beim ruhenden Finger nehmen Auflagekraft und Haftreibung ab. Sind Haft- und
Gleitreibung gleich groß, findet der Rollentausch statt. Der ruhende Finger
gleitet, der gleitende ruht. Dieses Wechselspiel geht so lange, bis sie sich
treffen.
Quellen: . Treitz, S.41;
Wittmann1, S.8; Götz, Band I /S. 275, Zeier, S.28, Perelman2, S.124, Gressmann, S.51,
Press, S.85, Borucki, S.104
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexpeimente".
Variationen:
1. Reibungsschwinger. Bürger, S.65
2.Rotierende
Scheiben Bublath 7-23
3. Ring mit Schlüssel hängt an rundem Bleistift. Neige den Stift, dass
Schlüssel gerade nicht rutscht. Wenn du nun drehst, rutscht er. Gressmann, S.50
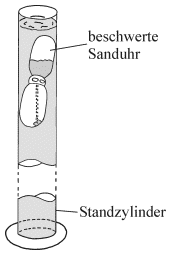
Sanduhr in schmalen, mit Wasser gefüllten Zylinder stecken. Dreh den Zylinder um, die Sanduhr sinkt erst, wenn genug Sand runtergerieselt ist. Der Sand im oberen Teil drückt die Uhr an die Wand, die Reibung hält die Uhr unten. Der Versuch ist heikel, die Gewichtskraft darf nur ein wenig größer als die Auftriebskraft sein.
Quellen Treitz, S.14; Bublath2-9; Götz, Band I/ S.278
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexpeimente".
Ein Glaszylinder wird mit Steinchen und Wasser gefüllt. Bei senkrechter Lage fallen die Steinchen langsamer als bei schräger Lage, da das Wasser als Gleitschicht dient.
Quelle: Bublath5- Kap.
5
In einem Brettchen ist ein Loch so gemacht, dasseine Metallkugel gerade halb hineinpasst. Mit Daumen und Zeigefinger soll die Kugel herausgeholt werden, ohne dabei das Brettchen zu bewegen. Der Trick: Drücke Daumen und Zeigefinger eine halbe Minute lang, und plötzlich klebt sie an den Fingern.
Quelle (mit Erklärung): Wittmann1, S.76
Lasse einen Ringe an einem senkrecht gehaltenem Stab rotieren (z.B Vorhangring an Vorhangstange oder Klebebandrolle an Fuß einer Stehlampe). Der Ring fällt nicht wegen der Reibung.
Quelle: Wittmann1, S.94
Stecke durch die größte Fläche einer leeren Streichholzschachtel eine
Stricknadel und in eine zweite Schachtel so viel Knete , dassbeide Schachteln
gleich schwer sind. Stelle beide hochkant auf einen Bleistift. Die zweite
Schachtel wird schneller runterfallen.
Quelle: Treitz, S.62
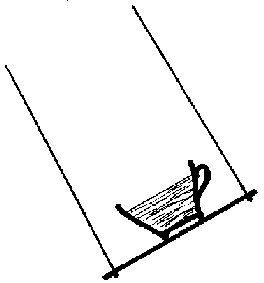
Ein Glas Wasser auf ein Brett mit zwei Schnüren (Schaukel) stellen und über Kopf rotieren lassen. Bei geschickter Durchführung bleibt man trocken.
Quellen: Oberdorfer ,
S.31, Treitz, S.19 (Quelle der Abbildung); Wittmann1, S.104, Lanners, S.49, Kratz3, S.2.08, Borucki, S.53
Glas umgestülpt über Kugel stellen. Du kannst Kugel mit dem umgedrehten Glas transportieren, wenn diese im Glas rotiert.
Quelle: Press, S.96
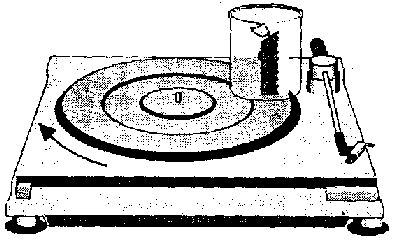
Eine Kerze in einem Glas (Windlicht) wird gedreht (z.B. auf einem Plattenteller). Die Flamme
weist nach innen.
Andere Möglichkeit: Luftballon, der mit einem Gas, das
leichter als Luft ist, gefüllt ist.
Wachsen rotierende Pflanzen nach innen?
Quellen: Melenk-Runge, S.42; Wittmann1, S.92; Zeier, S.51, Treitz, S.17, Gressmann, S.60 (Quelle der Abbildung); Bublath5-9
Das Ende eines Schlauchs wird in einen gefüllten Wassereimer gelegt. Das andere Ende lassen wir herumwirbeln. Das Wasser verlässt den Schlauch, und aus dem Eimer kommt neues nach.
Quelle: Gressmann, S.61
In einer durchsichtigen Plastikschachtel befinden sich zwei Kügelchen und am Rand zwei Mulden. Die Kugeln sollen in die Mulden befördert werden. Lösung: Versetze das Kästchen in Drehung.
Quelle: Wittmann1,
S.79,Bublath5-28
Ein Serviettenring genau in die Mitte eines Tellers (oder einer Frisbee-Scheibe) legen. Den Teller am Rand mit beiden hohl gehaltenen Händen fassen und mit drehender Bewegung in die Höhe werfen. Nach einer Umdrehung wieder auffangen. Der Ring bleibt nach viel übung an Ort und Stelle.
Quellen: Oberdorfer,
S.37, Lanners, S.42
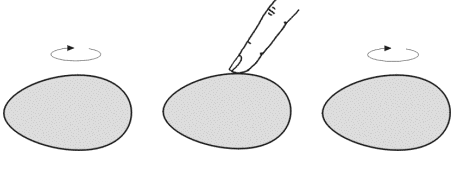
Ein rohes Ei wird in Drehung versetzt. Tippt man das Ei von oben an, dasses
kurz zum Stillstand kommt, und nimmt man dann sofort den Finger wieder weg, so
dreht sich das Ei weiter.
Ein gekochtes Ei würde liegen bleiben.
Weitere Versuche:
1. Ein
rollendes Ei antippen und bremsen. Ist es roh, so rollt es weiter.
2. Drehe ein rohes und ein gekochtes Ei (vorher schütteln) . Das gekochte Ei
stellt sich auf die Spitze, das rohe (unsymmetrisch) nicht.
3.
Gekochtes und rohes Ei schiefe Ebene runterrollen lassen. Das rohe ist
schneller, da es weniger Rotationsenergie aufnimmt .
Quellen: Backe, S.59, Zeier, S.52, Bublath1 Kap. 2; Gressmann, S.54; Bürger, S.37
Die Abbildung stammt aus der CD-ROM "Physikalische
Freihandexpeimente".
Eine Büchse mit Farbe füllen, die zweite mit Gips . Beide trocknen lassen. An der schiefen Ebene rollt die Gipsbüchse trotz gleichen Gewichts schneller als die Farbbüchse mit flüssigem Inhalt.
Quelle: Oberdorfer, S.46,
Bublath5 ,Kap.98
Variation: Die gedopte Walze Wittmann1, S. 81 .
Seltsam
rollende Kaffeedosen
Kratz3, 2.08
Wasserdose rollt schneller als Sanddose (innere Reibung).
Gressmann, S.56
Zwei gleiche Kugeln rollen auf Schienen, einmal ist Abstand der Schienen
klein, einmal größer. Die Kugel auf der dünnen Strecke rollt schneller.
Quelle: Bublath7-19
Ein eingekerbtes Holz mit Propeller mit einem anderen kleinen Stab streichen. Je nach Daumenstellung rotiert der Propeller mal links, mal rechts.
Quellen: Walker; Wittmann1, S.115, Oberdorfer, S.41, Kratz2, S.59
In ein Plexiglasbecken Wasser und Petrol (nicht mischbar) füllen. Durch
Schaukeln entstehen Wellen an der Grenzschicht zwischen Wasser und Petrol.
Quelle: Oberdorfer, S.98
Eine Stahlnadel in Korken auf (Bronze-) Münze legen und mit Hammer drauf.
Quellen: Wittmann2, S.8,
Zeier, S.19,33; Moisl1, S.73
Wir falten ein Blatt Papier und legen es mit der Faltkante über eine messerklinge. Beim Schneiden mit dem messer bleibt das Papier ganz.
Quelle: Press, S.94